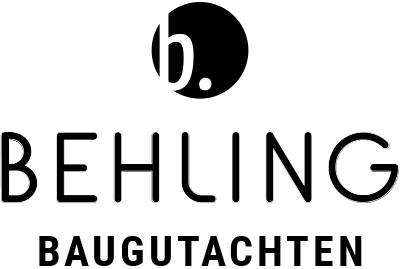Behling, Ihre Gutachter für Schimmel: Richtiges Heizen und Lüften in der kalten Jahreszeit
Schimmel bildet sich bei permanenter Feuchtigkeit. Diese Strategien helfen gegen den Schädling
Feuchtigkeitsmessung bei Schimmelbefall
Schimmelbefall ist aus mehreren Gründen sowohl ein Ärgernis als auch eine gesundheitliche Belastung. Zwar sind die allgegenwärtigen Sporen des Schimmelpilzes für gesunde Menschen ungefährlich, Patienten mit beeinträchtigtem Immunsystem oder Vorerkrankungen etwa der Lunge sollten eine Schimmelexposition auf jeden Fall vermeiden. Zu der ästhetischen Beeinträchtigung des Wohnraums greift der Schimmel - vorausgesetzt, er kann sich unbehindert ausbreiten - zudem die Bausubstanz der Gebäudehülle an. Als Ihre Gutachter für Schimmel haben wir eine Reihe nützlicher Informationen zum Thema zusammengestellt:
Was ist eigentlich Schimmel?
Wir haben es oben bereits erwähnt: Die Sporen des Schimmelpilzes schweben in der Luft, sie umgeben uns in großer Zahl und bleiben dabei unsichtbar. Erst, wenn die Bedingungen für die Ausbildung eines Mycels, also des sichtbaren Körpers des Pilzes, günstig sind, erscheint der Schimmel beispielsweise auf Zimmerwänden als schwarzer Belag. Dabei macht sich eine bestimmte Art der Schimmelpilze wie beispielsweise Chaetomium breit. Dieser durch seine Färbung auch als Schwärzepilz bekannte Pilz erfüllt in der Natur wichtige Funktionen beim Abbau organischer Substanzen. In Gebäuden zerstört er Baumaterial. Da Pilze weder Tiere noch Pflanzen sind, sind sie auf gelöste Nährstoffe angewiesen, die sie aus dem befallenen Untergrund ziehen. Im Fall des Chaetomium ist das die Zellulose, die sich im Tapetenkleister, im Papier der Tapete oder in Holz befindet. Der Pilz erzeugt zur Verdauung seiner Nährstoffe ein Enzym, das auch für den typisch muffigen Schimmelgeruch verantwortlich ist. Damit sich Schimmel entwickeln kann, müssen eine Reihe von Umgebungsbedingungen gegeben sein. Um keimen zu können, benötigt er eine spezifische Temperatur, wenig UV-Bestrahlung, einen nährstoffreichen Untergrund mit einem bestimmten pH-Wert sowie einen definierten Sauerstoffgehalt der Luft. Der wichtigste Faktor ist jedoch Feuchtigkeit, ohne die kein Schimmelpilz gedeihen kann.
So breitet sich Schimmel in Gebäuden aus
Gutachter für Schimmel kennen das Problem: Feuchtigkeit, der Hauptfaktor der Schimmelbildung, hat in Gebäuden viele unterschiedliche Quellen. Nicht immer muss es ein überfluteter Keller sein, der einer Schimmelbildung Vorschub leistet. Auch Luftfeuchtigkeit und schleichend eindringendes Wasser können die Bildung der Pilze in Gebäuden begünstigen. Die meisten Schimmelpilzarten benötigen eine Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent:
- Alle Baustoffe binden Wasser. Das gilt sowohl für die verwendeten Steine, als auch den Mörtel, das Holz, den Putz u.v.a. Diese Feuchtigkeit wird noch Jahre nach Fertigstellung des Gebäudes in die Umgebungsluft abgegeben. Dazu kann bei alten Gebäuden oder Neubauten mit Bauschäden Wasser durch Rissbildung und allgemeinen Verschleiß (Kapillarrisse im Mauerwerk, undichte Fenster oder beschädigte Dächer) eindringen.
- Unglücksfälle mit Wasser: Sowohl Hochwasser als auch Rohrbrüche oder eingedrungener Regen/Schnee, der nicht richtig austrocknet, beschädigen die Bausubstanz.
Schimmel ist kein Problem ausschließlich älterer Gebäude. Als Gutachter für Schimmel helfen wir auch Bauherren und Eigentümern von Neubauten mit unserer Expertise.
Schimmelbefall durch falsches Heizen und Lüften
Deutlich komplizierter, aber auch wesentlich häufiger als die beschriebenen Fälle, tritt der Schimmelbefall durch falsches Heizen und Lüften auf. Dabei ist eine Grundfeuchtigkeit in der Wohnung ganz normal. Der menschliche Körper setzt permanent Feuchtigkeit frei, durch diverse Tätigkeiten im Haus (kochen, wischen, baden, Wäsche trocknen etc.) entsteht ein dauerhaft feuchtes Milieu. Einer intakten Bausubstanz macht ein gewisses Maß an Feuchtigkeit nichts aus.
Schimmel greift die Bausubstanz an
Bildet sich jedoch aufgrund mehrerer Faktoren Kondenswasser, ist eine Grundbedingung zur Schimmelbildung vorhanden. Eine Reihe weiterer Faktoren begünstigen den Schimmel ebenfalls:
- Viele moderne Gebäude besitzen besonders dichte Fenster und Wärmedämmung. Zusammen mit schlechtem Lüften und mangelhaftem (= ungenügendem) Heizen bildet sich dann Tauwasser, wenn die Luftfeuchtigkeit beispielsweise an ausgekühlten Wänden kondensiert
- Wärmebrücken (also Zonen im Gebäude, in denen die Wärme schneller abtransportiert wird als in der Umgebung) fördern ebenfalls die Kondenswasserbildung. Vor allem an Bauteilen wie Fensterrahmen, Heizkörpernischen und Rollladenkästen treten solche Wärmebrücken auf
- Fehlende oder defekte Dampfbremsen/Dampfsperrfolien lassen Kondenswasser diffundieren. Einen ähnlichen Effekt können Möbelstücke haben, die direkt an der Wand stehen
- Als Gutachter für Schimmel raten wir: Nachträgliche Wärmedämmung sollte mit einer Veränderung des Lüftens/der Heizungsgewohnheiten einhergehen, ansonsten droht auch hier Kondenswasserbildung
Hinter der Kommode hat sich Kondenswasser gebildet. Die Folge: Schimmelbefall
Schäden durch Schimmel
Wie bereits erwähnt, sind Pilze darauf angewiesen, ihre überlebenswichtigen Nährstoffe gelöst aus ihrem Untergrund (Substrat) zu ziehen. Eine Möglichkeit zur Photosynthese wie Pflanzen besitzen sie nicht. Dadurch zerstören sie allerdings den Baustoff, auf dem sie siedeln. Holzteile oder Tapeten überstehen langen und starken Schimmelbefall nicht. Daneben ist bei großflächigem Schimmelbewuchs auch mit gesundheitlichen Schäden zu rechnen. Einzelne, kleine Ausdehnung sind ästhetisch störend, wenn auch unproblematisch für die Gesundheit.
Anders verhält es sich bei großflächigem oder besonders dichtem Schimmelbefall. Hier sind besonders Personen mit Vorerkrankung, speziell Lungenerkrankungen und Allergiker betroffen. Bei sehr starker Exposition (wenn beispielsweise die Atemluft besonders viele Pilzsporen aufweist) kann der Schimmel auch eine toxische Wirkung entwickeln.
Dem Umweltbundesamt zufolge sollte Schimmel gemäß seiner Ausdehnung in der Fläche in drei Kategorien eingeteilt werden: Schadensfläche kleiner als 20 Quadratzentimeter, kleiner als 0,5 qm und größer als 0,5 qm. Die letztgenannte Schadenskategorie birgt ein Gesundheitsrisiko und muss beseitigt werden. Dazu wird die Freisetzung der Pilzsporen unmittelbar bekämpft, die Ursache des Pilzbefalls beseitigt und die betroffenen Bewohner umweltmedizinisch betreut werden. Anschließend sollte eine Messung der Schimmelsporenbelastung erfolgen.
Gut sichtbare Schäden durch tief gehenden Schimmelbefall
Schimmelbefall entfernen
Die gute Nachricht bei Schimmelbefall: Die Pilze lassen sich gut bekämpfen. Ab einer bestimmten Größe sollten jedoch nur Fachleute in Schutzkleidung die Flächen behandeln. Dabei kommt es auf die Schadenskategorie (1,2,3) an; die Sanierungsarbeiten müssen entsprechend des Leitfadens des Umweltbundesamtes erfolgen. Hier sind auch die Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Schutzkleidung) bei der Schimmelbekämpfung beschrieben. Die Maßnahmen sind letztlich auch von der Nutzung des Gebäudes abhängig. Diese Maßnahmen können wir nicht empfehlen:
- Wasser und Bürste reichen zur Bekämpfung des Schimmel nicht aus
- Das Gleiche gilt für die Verwendung von Essigreiniger
- Fungizide aus dem Baumarkt enthalten i.d.R. Chlor. Deren Ausdünstungen können gefährlicher sein als der Schimmel selbst
- Auch wenn viele Ratgeber ihn empfehlen, verzichten Sie auf den Einsatz eines Föns. Durch das Gebläse werden die Sporen weitergetragen
- Das Übermalen des Schimmel mit fungiziden Farben ist ebenfalls nicht zu empfehlen. Unter Umständen können die Pilze unter dem Farbbelag überleben und sich ausbreiten.
Professionelle Schimmelbeseitigung
Sie sollten stattdessen folgende Tipps beachten:
- Soweit es geht, sollte der Untergrund (z.B. Tapeten) auf dem sich die Schimmelpilze ausbreiten , entfernt werden
- Den Schimmelpilz mit mindestens achtzigprozentigem Alkohol besprühen
- Die befallenen Stellen luftdicht mit PE-Folie abkleben
- Die betroffenen sowie die angrenzenden regelmäßig Räume naß reinigen
Behling, Ihre Gutachter für Schimmel: So vermeiden Sie Schimmelbildung
Der Königsweg, Schimmel zu vermeiden, ist das richtige Heizen und Lüften. Dazu ist die Temperatur der Raumluft relevant. Kalte, trockene Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme Luft. Gerade im Winter, bei steigendem Niederschlag, sinkenden Temperaturen und in der Heizphase besteht ein erhöhtes Schimmelrisiko. Durch die hohen Temperaturunterschiede zwischen Wand und Raumluft kann sich Kondenswasser bilden. Mit ein paar Maßnahmen wirken Sie dieser Entwicklung entgegen:
- Eine leicht geheizte Wohnung (idealerweise 20°C), die regelmäßig gelüftet wird, ist der beste Weg, Schimmel zu vermeiden
- Stoßlüften geht vor Fenster kippen. Mehrmals am Tag sollten die Wohnräume quergelüftet werden; d.h., dass durch das Öffnen mehrerer Fenster wird ein Durchzug erzeugt, der einen schnellen Luftaustausch ermöglicht und ein Auskühlen der Wohnung verhindert
- Bei tiefen Temperaturen reichen in der Regel fünf bis zehn Minuten Lüften aus
- Badezimmer oder Waschküchen bzw. Alle Räume, in denen mit heißem Wasser gearbeitet wird, sofort lüften. Das gilt auch für Schlafzimmer, da Menschen im Schlaf Feuchtigkeit emittieren
- Neubauten geben besonders viel Wasser in die Umgebung ab, weshalb sie häufig gelüftet werden sollten
- Liegen Räume mit stark unterschiedlichen Temperaturen nebeneinander (Bad und Schlafzimmer), sollte die Tür dazwischen immer geschlossen bleiben, um die Raumklimata voneinander zu trennen
- Eine Verglasung mit hoch gedämmten Fenstern in Altbauten mit schlecht gedämmten Fassaden kann kontraproduktiv sein, da der Taupunkt sich verschiebt und ggf. eine Schimmelbildung fördert
Bildnachweis: Bild 1: PPC Photography Cologne/Shutterstock, Bild 2: D_Townsend/Shutterstock, Bild 3: urbans/Shutterstock, Bild 4: Jocic/Shutterstock, Bild 5: Heiko Kueverling/Shutterstock